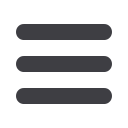

Starke Kinder
mit Zerebralparese
Eckdaten und Umwelten
Bei Kindern mit Zerebralparese (CP) schränkt eine be-
einträchtigte Muskelfunktion (Spastizität, Muskelschwä-
che, beeinträchtigte selektive Ansteuerung) die Ausfüh-
rung von Alltagsaktivitäten sowie die Mobilität erheblich
ein. Damit rücken Behandlungsziele – wie größtmögliche
Eigenaktivität, Problemlösekompetenz in der Interaktion
mit den Umfeldgegebenheiten sowie Unterstützung der
sozialen Teilhabe – in den Vordergrund.
Im therapeutischen Zugang hat sich in den letzten Jahren
ein deutlicher Wandel vollzogen. Die Maßnahmen gehen
heute weit über Inhibition, Dehnung, Fazilitation und
Aktivierung antagonistischer Muskulatur hinaus. Während
die Spastizität als charakteristisches Merkmal der Zere-
bralparese in vielen Therapiekonzepten repräsentiert ist,
wurde die Problematik der Minussymptomatik (im Beson-
deren die Verminderung von Muskelkraft) lange Zeit
wenig beachtet.
Heute geht man davon aus, dass vor allem die Muskel-
schwäche ein Kind in seiner Mobilität hindert und der
Kraftmangel als zentraler Punkt der motorischen Ein-
schränkung zu sehen ist. Vor wenigen Jahren noch galt
Krafttraining bei Kindern mit Zerebralparese als nicht
angemessen, es galt das Paradigma »Widerstand erhöht
die Spastik« oder »Anstrengung führt zu einer Erhöhung
des Tonus«. Im aktuellen wissenschaftlichen Diskurs wird
Krafttraining als anerkannte Intervention immer mehr
akzeptiert.
Damiano & Abel konnten eine signifikante Verbesserung
im Gehen, Laufen und Springen (gemessen mit dem
Gross Motor Function Measure GMFM, Dimension E) und
eine Zunahme der Ganggeschwindigkeit nachweisen.
Die Autoren betonen die Bedeutung eines individuell
auf das Kind abgestimmten Trainingsprogramms, da in
dessen Rahmen die schwächsten Muskeln trainiert
werden. Signifikante Verbesserungen zeigten sich auch
in der Ausdauer beim Antreiben des Rollstuhls.
Die Trainingsintensität soll langsam gesteigert werden,
basierend auf dem individuellen Kraftlevel des Kindes.
Am ehesten geeignet ist hierzu die Bestimmung des RM
(repetition maximum) – bei welchem maximalen Gewicht
schafft das Kind die 15 Wiederholungen in korrekter
Ausführung der Bewegung. Scholtes sieht in einer fort-
schreitenden Belastung bis zum Überlastungsprinzip
(progressive resistence exercise, PRE) die besten
Trainingseffekte.
Krafttraining ist bei leichter bis moderater CP (Level I-III
nach dem GMFCS) besonders sinnvoll. Begonnen
werden soll spätestens ab dem siebten, besser ab dem
fünften oder sechsten Lebensjahr, wenn das Kind ein
Verständnis für das Training entwickeln kann.
Es werden Single-joint- und Multi-joint-Übungen ausge-
führt, sowohl mit konzentrischer als auch mit exzentri-
scher Muskelaktivität. Jedoch sollte bei sehr schwacher
Muskulatur zunächst mit Single-joint-Übungen begonnen
werden, um die Mitinnervation stärkerer Muskeln in einer
Bewegungsfolge zu verhindern.
Götz-Neumann betont die Bedeutung der exzentrischen
Kontrolle der Bewegung zur Verbesserung der Gehfähig-
keit. Exzitation und Sprungkrafttraining der Waden-
muskulatur sowie Kräftigung der becken- und hüft-
stabilisierenden Muskulatur ermöglichen bessere will-
kürliche Ansteuerung und eine funktionellere motorische
Kontrolle. Es wird zunächst konzentrisch, in weiterer
Folge isometrisch und exzentrisch mit zunehmender
Geschwindigkeit der Ansteuerung zur Verbesserung
der Standbeinphase trainiert.
Trotz nachgewiesener Effektivität bleiben die Effekte in
der Mobilität noch begrenzt. Dies könnte daran liegen,
dass eine Verbesserung der Mobilität auch Koordination
und Gleichgewichtstraining beinhalten muss. Moderne
Konzepte zum Krafttraining bei CP schließen bedarfsge-
recht auch Laufband-Therapie, gerätegestütztes Kraft-
training, Constrained-Induced Movement Therapy und
weitere mit ein. Nicht zuletzt sollte Krafttraining aber
auch Freude machen. Ein Gruppentraining könnte hier
nicht nur die Freude, sondern auch die Motivation und
das Selbstbewusstsein des Kindes erhöhen.
Physiotherapie bei CP ist stetig im Wandel, und das ist
gut so! Sie will Kinder stärken – in ihrer motorischen
Handlungskompetenz, aber auch in ihrem Selbstwert.
Nur so werden wir längerfristig die besten Therapie-
erfolge erzielen: nicht nur Funktion verbessern, sondern
auch Partizipation ganz im Sinne der ICF-Kriterien.
䡧
Progressives Krafttraining bei Kindern mit zerebraler Bewegungs-
störung ab dem siebten Lebensjahr führt zu verbesserter Aktivität
und Partizipation im Alltagsleben und rückt damit stärker in den
Fokus der therapeutischen Aufmerksamkeit
28
physio
austria
inform
Februar 2017
Themenschwerpunkt
Physiotherapie und Menschen mit Behinderung
















