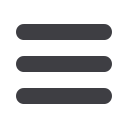

38
physio
austria
inform
Dezember 2016
Die Menge des unfreiwilligen Harnverlusts kann durch
den »Vorlagentest« erfasst werden. Hierzu wird die
Vorlage im trockenen Zustand gewogen und mit dem
Gewicht der eingenässten Vorlage verglichen. Ein Milli-
gramm Mehrgewicht entspricht einem Milliliter Harn-
verlust. Die Tests können als Langtest (24 Stunden) oder
Kurztest (eine Stunde) durchgeführt werden. Auch wenn
der Test wenig befriedigende wissenschaftliche Qualität
zeigt, wird er doch als ein im Alltag der Physiotherapie
einfach durchzuführendes und für die PatientInnen gut
umsetzbares Assessment eingesetzt.
Untersuchen und Beurteilen der Intaktheit von
Funktionen im Beckenboden- und Rumpfbereich
Für die Erfassung des vaginalen Ruhetonus stehen
mehrere standardisierte Skalen zur Verfügung:
Devreese’s tonicity scale, Reissing’s tonicity scale,
Dietz’s tonicity scale. Alle Skalen verwenden eine digitale
Untersuchungsmethode. Es werden die Elastizität,
Stiffness und die Reaktion auf Dehnung der Vaginalwand
in den drei Etagen der Beckenbodenmuskulatur unter-
sucht und quantifiziert. Diese Untersuchungen sind
vor allem bei Retentionssymptomen sowie Schmerzen
im Uro-Genitalbereich wichtig. Die Skalen zeigen
moderate bis hohe Intertester Reliabilität.
Für die Erfassung von Lage, Intaktheit und Morphologie
der Beckenmuskulatur verwenden sowohl die Methode
nach Dietz als auch der LAM (Levator ani muscle) attach-
ment grading scale vaginale Verfahren der Palpation und
erheben die Trophik und die Intaktheit der Levatorschen-
kel. Dietz et al. (2012) konnten hohe Konstruktvalidität
(Korrelation zu Ultraschalluntersuchung) nachweisen.
Beide Techniken zeigen eine ausgezeichnete Intertester-
Reliabilität. Diese Untersuchungen sind insbesondere bei
Frauen nach Geburten bedeutsam, da sie mögliche Ver-
letzungen der tiefen Beckenmuskulatur erfassen und so
im therapeutischen Prozess die Prognose beeinflussen.
Tests und Assessments in der
Arbeit mit Kontinenzstörungen
Zentrale Ziele physiotherapeutischer Untersuchungen
Beeinträchtigungen der Kontinenz mindern die Lebens-
qualität und das Selbstwertgefühl der Betroffenen in
hohem Maße. Die Untersuchung des Beckenbodens
nimmt einen wichtigen Teil der physiotherapeutischen
Kontinenzarbeit ein. Inkontinenzsymptome und Organ-
senkung korrelieren erwiesenermaßen mit einem Verlust
an struktureller und funktioneller Integrität des neuro-
myofaszialen Systems der pelvinen Diaphragmen und
des Sphinkterkomplexes. Entsprechende Defizite werden
durch eine Kombination von Befunden aus der Inspektion
und Palpation des uro-prokto-genitalen Beckenbereichs
und Assessments zur Erfassung der Lebensqualität (QoL)
erhoben. Es stehen standardisierte und validierte
Assessments zur Verfügung.
Quantitative und qualitative Erfassung
des Symptoms Inkontinenz
Die Arbeitsgruppe International Consultation on Inconti-
nence Modular Questionnaire (ICIQ) wurde 1998 mit dem
Ziel gegründet, standardisierte Fragebögen zu entwickeln
und zu validieren sowie diese weltweit für die Erfassung
der Probleme der unteren Harnwege, von Darmfunktions-
störungen und Störungen im Genitalbereich zur Ver-
fügung zu stellen. Aktuell stehen aus der ICIQ-Gruppe
in bis zu 18 Sprachen übersetzte Fragebögen für zwölf
unterschiedliche klinische Krankheitsbilder zur Ver-
fügung. Alle Fragebögen erfassen objektive und subjek-
tive Parameter des Krankheitsgeschehens und der
Lebensqualität. Baessler und Kempkensteffen erstellten
und validierten den »Deutschen Beckenbodenfrage-
bogen« zur Erfassung von Blasen-, Darm-, Deszensus-
und von sexuellen Problemen und deren Auswirkung
auf die Lebensqualität bei Männern und Frauen. Im Ge-
gensatz zu den Fragebögen der ICIQ-Gruppe ist dieses
Instrument sehr umfassend und zeitaufwändig. Beide
Assessment-Bögen können jedoch gut selbstständig von
KlientInnen ausgefüllt werden und sind daher in der
Praxis leicht einsetzbar.
Das Miktionstagebuch erfasst die Abweichungen im
Harnverhalten über ein 24-Stunden-Protokoll. Trink-
und Harnmengen werden gemessen und notiert. Zudem
wird dargestellt, ob die Miktion durch einen Drang
initiiert worden ist. Die Anzahl und Größe verwendeter
Hilfsmittel wird aufgeführt und die Menge des Harnver-
lustes quantifiziert. Die ausgeführten Alltagsaktivitäten
werden im Tagesablauf notiert. Diese Aufzeichnungen
können interpretiert werden und erfassen die Art der
Kontinenzstörung und das Ausmaß der Dysfunktion der
Ausscheidungsorgane. Miktionstagebücher sind wert-
volle Erstbefunde und sehr gute Möglichkeiten der
Verlaufstestung.
Fokus
Qualität
Kontinenzstörungen können unterschiedliche Ursachen haben und gehen mit
einer Vielzahl von strukturellen und funktionellen Störungen der myofaszialen
Anteile des Beckens sowie der Beckenorgane einher. PhysiotherapeutInnen
stehen eine Auswahl an Testverfahren zur Verfügung, die eine genaue Unter-
suchung der Intaktheit von Kontinenzmechanismen sowie der Auswirkung
von Kontinenzstörungen bei täglichen Aktivitäten und in der individuellen
Partizipation ermöglichen.
Hypothese 1
Die stabilisierende und reaktive Funktion des Becken-
bodens in Bezug auf die Lagesicherung der Organe ist
bei niederem Tonus reduziert und begünstigt die Belas-
tungsinkontinenz. Ein erhöhter Tonus führt zu Störungen
der Trophik, fördert Triggerpunktbildung und Schmerz.
Hypothese 2
Die Verletzung der Beckenbodenmuskulatur führt
zu einer Asymmetrie im Beckenring und zu einem
Stabilisationsverlust der Beckenorgane.
















