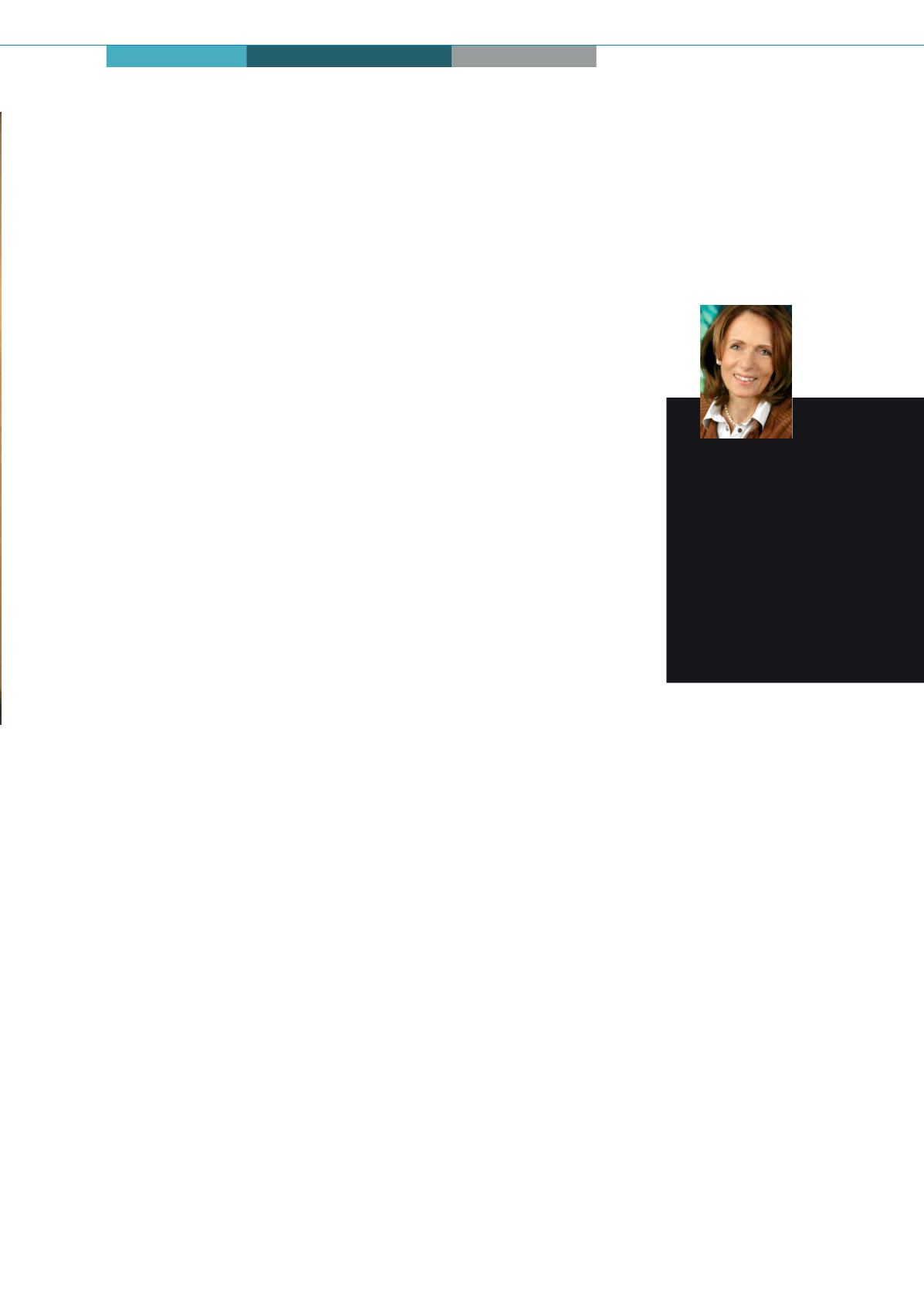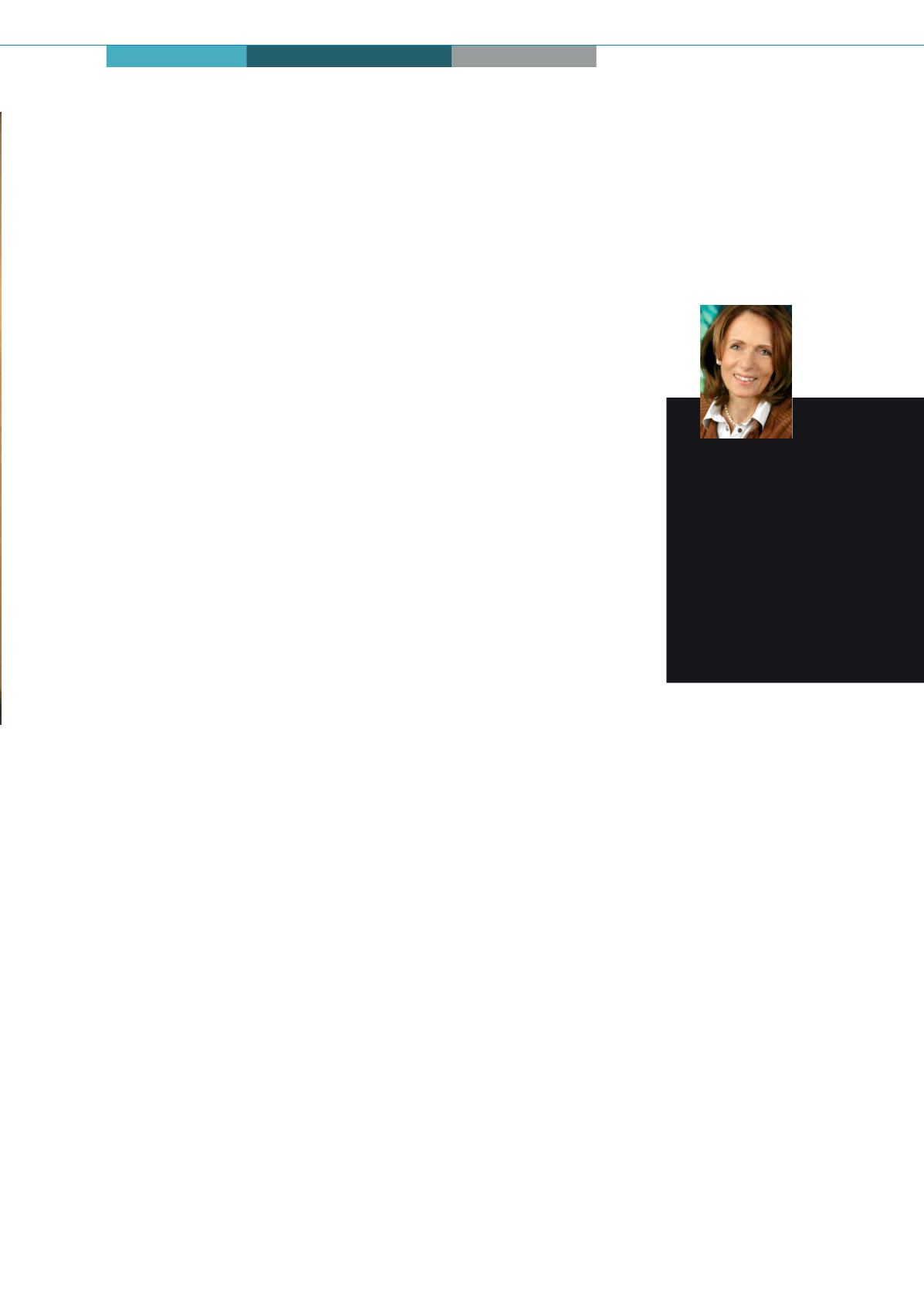
FEEDBACK
Barbara Gödl-Purrer, MSc
Das Üben von Bewegungshandlungen ist
ein Kerngebiet der physiotherapeutischen
Praxis. Dabei werden Art und Intensität des
Übens durch die im Befund durchgeführte
Analyse relevanter Bewegungen bestimmt.
Bereits in der Anamnese werden die Ein-
schränkungen der PatientInnen in Funktion
und Aktivität erfasst und daraus Hypothesen
in Bezug auf die Störungen der motorischen
Kontrollleistung abgeleitet, sowie durch
geeignete Assessments evaluiert (Jones &
Rivett 2004). Unter Einbeziehung der
Kenntnisse pathobiologischer Mechanismen
und der beitragenden Faktoren, die die
Veränderbarkeit der Bewegungsstörung
determinieren, wird das therapeutische
Übungskonzept erstellt (Grillo Juszczak
in Gantert & Suppé 2007; Sahrmann
et al. 2011).
Auf struktureller und/oder funktioneller
Ebene werden Übungen zur Wiedererlangung
und Leistungsoptimierung motorischer Teil-
leistungen durchgeführt. Auf Aktivitäten-
ebene werden komplexe Bewegungsmuster
des individuellen motorischen Grundreper-
toires von Alltagsbewegungen neugelernt
oder wiedererlernt. Auf Partizipationsebene
wird die Integration dieser Bewegungen in
motorische Handlungen im individuellen
Umfeld integriert. In jeder Situation strebt
therapeutisches Üben einerseits einen
Trainingseffekt für relevante Körperstruktu-
ren und zentrale Bewegungssteuerungs-
mechanismen an (quantitativer Aspekt),
andererseits wird auf die Qualität der Bewe-
gungsausführung höchster Wert gelegt, um
so dem Anspruch zu entsprechen, bei opti-
maler Bewegungsleistung maximale Ökono-
mie in der biomechanischen Belastung der
Körperstrukturen zu sichern. So soll der
Prozess des Übens zur Optimierung von
motorischer Leistungsfähigkeit beitragen.
Forschungsergebnisse zeigen, dass der Ein-
satz von Feedback steuernd auf diesen Lern-
prozess wirken kann (Shumway-Cook &
Woollacott 2012, Gantert & Suppé 2007).
Feedback und Biofeedback
Feedback (FB) bedeutet »Rückkoppelung«
und wird laut Duden in zweierlei Richtung
definiert. Einerseits als »…. zielgerichtete
Steuerung eines technischen, biologischen
oder sozialen Systems durch Rückmeldung
der Ergebnisse, wobei die Eingangsgröße
durch Änderung der Ausgangsgröße beein-
flusst werden kann (Kybernetik)«, anderer-
seits als … »eine Reaktion, die jemandem
anzeigt, dass ein bestimmtes Verhalten, eine
Äußerung o.Ä. vom Kommunikationspartner
verstanden wird [und zu einer bestimmten
Verhaltensweise oder -änderung geführt
hat]« (
-
bung/Feedback).
Herderschee et al. (2011) beschreiben FB als
jede Form der verbalen oder visualisierenden
Rückmeldung, die während oder nach einer
Bewegungsausführung gegeben wird. Bio-
feedback (BFB) wird von den AutorInnen als
eine Form des FB definiert, die an sich nicht
wahrnehmbare biologische Signale des
Körpers während einer motorischen Hand-
lung apparategestützt ableitet und zeitgleich
oder zeitversetzt der übenden Person
rückkoppelt.
FB oder BFB dient in jedem Fall der Unter-
stützung des motorischen Lernprozesses.
Die während einer Bewegungshandlung ab-
laufenden Steuerungs- und Wahrnehmungs-
prozesse sind den Menschen normalerweise
nicht bewusst. Nur das Ergebnis der Hand-
lung wird wahrgenommen (Zielorientierung)
und ständig mit dem bereits gespeicherten
und antizipierten Bewegungsergebnis vergli-
chen (Mulder 2007; Gantert & Suppé 2007).
FB greift in den Bewegungslernprozess ein,
indem es während einer Bewegung das
»Knowledge of Performance« (KP) oder nach
der Bewegung das »Knowledge of Result«
(KR) verstärkt und bewusst macht. Dies
kann dazu beitragen, die Eigenkontrollfähig-
keit über die Bewegung aufzubauen (Shum-
way-Cook & Woollacott 2012; Wulf 2007).
Barbara Gödl-Purrer, MSc
ist Lehrende an der
FH JOANNEUM Graz. Diplom
der Physiotherapie an der
Schule für den Physiothera-
peutischen Dienst am LKH
Salzburg (1979). Berufliche
Erfahrungen und Weiterbildun-
gen auf dem Gebiet Thorax-
physiotherapie, Orthopädie,
Traumatologie, Urologie,
Gynäkologie, Proktologie.
Feedbackgesteuertes Üben
in der Physiotherapie
Feedback und Biofeedback bieten Übenden die Möglichkeit, sich selbst
und die eigene Leistungsfähigkeit zu überprüfen, was die Freude am Üben
und den Leistungswillen steigern kann.
© Barbara Gödl-Purrer, MSc
physio
austria
inform
Juni 2014
7