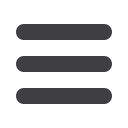

Interdisziplinäre Zusammenarbeit im Zentrum
Verletzte SpielerInnen kamen durch die enge Zusammenarbeit
mit Mannschaftsarzt Christian Gäbler überaus schnell und
unkompliziert in den Genuss von ärztlicher und bildgebender
Untersuchung und in weiterer Folge der indizierten Behand-
lung. Von nicht minderer Bedeutung ist die Zusammenarbeit
mit den das Kraft- und Konditionstraining steuernden Traine-
rInnen. Ein konkretes Beispiel dafür war die unmittelbare
Reaktion auf die Häufung von Patellarsehnenansatzentzündun-
gen im Laufe des Offseason-Programmes der Kampfmann-
schaft 2015/16. Schnelle und direkte Information ließen die
TrainerInnen direkt reagieren und Veränderungen in den Trai-
ningsplänen in Kombination mit therapeutischen Maßnahmen
brachten das Problem unter Kontrolle.
Eine besondere Herausforderung stellt die Betreuung der
hochintensiv trainierenden adoleszenten AthletInnen dar. Das
Interesse der SportlerInnen und ihrer TrainerInnen, möglichst
effizient stärker, schneller und in der Sportart erfolgreicher zu
werden, kann vor allem im Rahmen der einsetzenden Pubertät
problematisch werden. Die resultierenden Veränderungen, die
die Anpassung an Trainingsreize beschleunigen und innerhalb
kürzester Zeit für veränderte Verhältnisse für einen sich noch
im Wachstum befindlichen passiven Bewegungsapparat sor-
gen, können zu Überlastungsproblem an Wachstumsfugen
und Gelenksknorpel führen. Eine schwierige Situation für alle
Beteiligten, denn derartige Pathologien müssen oftmals durch
Sportkarenz beziehungsweise Belastungsreduktion behandelt
werden. Den geliebten Sport nicht ausüben zu dürfen, bedeu-
tet natürlich auch Probleme mit Selbstidentifikation, Selbst-
wert und die Unterbrechung von regelmäßigen sozialen
Kontakten für die Jugendlichen, was die Akzeptanz und daraus
resultierend die Compliance der PatientInnen reduzieren kann.
Im Kontrast dazu steht die Arbeit mit den »Super Seniors«,
einer zwischen Tapferkeit und Unvernunft agierenden Sektion
des Vereins, in der sich langgediente Veteranen des Sports
oder Spätberufene den Schulterschutz überstreifen und den
behandelnden PhysiotherapeutInnen ein breites Spektrum an
degenerativ bedingen Pathologien bieten. Hier zwickt natur-
gemäß keine Wachstumsfuge mehr, dafür plagen Tendinosen,
Arthrosen und Discusdegeneration die Aktiven. Als Kontra-
punkt dazu das Team der Cheerleader – junge Mädchen und
Frauen, für die Beweglichkeit mit das höchste Gut und die
angeborene Laxität eine die Sportausübung begünstigende
Eigenschaft ist, zumindest bis sich daraus Instabilitäten
entwickeln und die Sportausübung nicht mehr begünstigen.
Wunderwaffe Taping
Was vereint fast alle AthletInnen, mit denen ich im Rahmen
meiner Tätigkeit zu tun hatte? Die Liebe für Tapeverbände.
Ob strukturell sinnvoll – zum Beispiel als präventives Sprung-
gelenkstaping vor Spielen – oder fragwürdig sinnvoll – wildeste
bunte Tapevarianten – Taping gilt unter SportlerInnen als
Wunderwaffe. Für den Behandler gilt hier zu differenzieren:
probates psychologisches Mittel bei Blessuren oder die klare
Info an die verletzten SportlerInnen, dass ernsthafte Verletzun-
gen anderer Versorgung bedürfen. Wie sieht mein Resümee
meiner Zeit als Physiotherapeut des österreichischen Rekord-
meisters und fünffachen europäischen Klubmeisters aus?
Harte Arbeit, viel Einsatz und ein massiver Gewinn an klini-
schen Fähigkeiten. Jeder in Orthopädie und Traumatologie
Tätige wird durch eine solche Tätigkeit massiv an Fähigkeiten
und Erfahrung in Befundung und Behandlung dazu gewinnen.
Alexander Salecic, MSc
600 Aktive vom Kindes- bis ins Seniorenalter, in Sektio-
nen vom kontaktarmen Flagfootball, über das Aushänge-
schild des Vereines, die national und international
erfolgreiche Tackle-Football-Kampfmannschaft bis hin
zu Ladies Football, Super Seniors und das gesamte
Cheerleading-Programm erfordern ein Verständnis von
typischen Pathologien in verschiedensten Altersklassen
und Anforderungsprofilen. »Dancing is a contact sport.
Football is a collision sport«, sagte der legendäre Football-
Coach Vince Lombardi. Eine Aussage, die verdeutlicht,
was uns bei der Arbeit in diesem Sport erwartet. Sowohl
was akute Verletzungen betrifft, als auch was durch
kongenitale Faktoren oder durch Überlastung bedingte
Krankheitsbilder betrifft, wird ein Höchstmaß an Fähig-
keiten in der Befundung verlangt. Denn tagtäglich wollen
die betroffenen AthletInnen wissen, was ein »Autschi«,
also eine vernachlässigbare Blessur, ist und was eine
Verletzung, die weiterer ärztlicher Abklärung bedarf.
Herausforderungen für die Physiotherapie
Die typischen Krankheitsbilder im American Football
umfassen Traumata an Sprunggelenken (viele Supinati-
onstraumata), Kniegelenken (Meniscus, Vorderes Kreuz-
band, Innenband), Schultern (Luxationen), Händen (hier
vor allem Daumengrundgelenksinstabilitäten und Kapsel-
verletzungen der proximalen Interphalangealgelenke)
sowie Überlastungssyndrome an Knien, Füßen und
Schultern. In Zusammenhang mit den hochkompressiven
Belastungen durch die Sportausübung und intensivem
Krafttraining finden sich ebenso häufig akute und chroni-
sche bandscheibenbedingte Problematiken.
Sportarten, wie speziell American Football, Rugby und
Eishockey, stellen das medizinische Fachpersonal vor eine
weitere große Herausforderung. Früher oftmals als unbe-
deutend und ungefährlich abgetan, ist im Lauf der letzten
Jahre das Bewusstsein um die Wichtigkeit des korrekten
Umgangs mit Gehirnerschütterungen rasant gewachsen.
ÄrztInnen oder PhysiotherapeutInnen vor Ort müssen in
der Lage sein, die AthletInnen unmittelbar auf eine mög-
liche Contusio Cerebri zu untersuchen und bei klinischen
Zeichen dafür und auch im Zweifelsfall die weitere Sport-
ausübung unbedingt untersagen. In weiterer Folge
müssen die Betroffenen Untersuchungen durch eineN
NeurologIn zugeführt werden und in einen vorsichtigen,
stufenweisen und am Erreichen spezifischer Vorgaben
orientierten Plan zum Wiedereinstieg in Training und Wett-
kampf eingegliedert werden. Auch wenn Physiotherapeu-
tInnen natürlich nicht diese Vorgaben erstellen, können
und müssen wir im täglichen Umgang mit den SportlerIn-
nen die Einhaltung dieser Kriterien mit kontrollieren und
die Hintergründe dieser Maßnahmen verstehen.
Der SCAT3-Test ist frei auch in deutscher Sprache aus
dem Internet herunterladbar und existiert in einer Version
für Kinder und Erwachsene. Es gilt, unbedingt, das
»Second Impact Syndrome« zu vermeiden. Ein initiales
Schädel-Hirn-Trauma, auch ohne Bewusstseinsverlust,
erhöht das Risiko für eine weitere, noch schlimmere
Läsion mit eventuell weitreichenden Konsequenzen,
massiv. Natürlich bedingen die beschriebenen Umstände
eine enge Zusammenarbeit und gute Kommunikation mit
den TeamärztInnen und den für die sportliche Betreuung
der Mannschaft verantwortlichen Coaches.
PRAXIS
Alexander Salecic, MSc
physio
austria
inform
April 2016
23
















