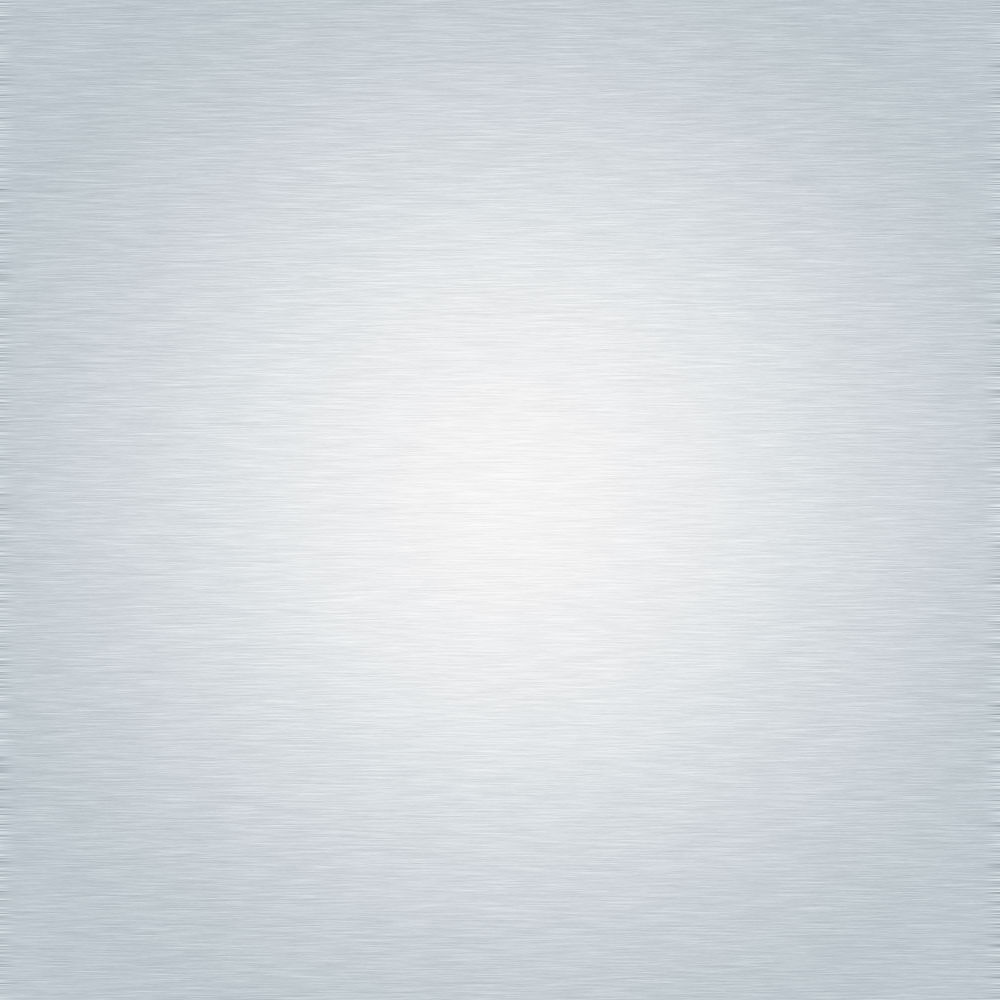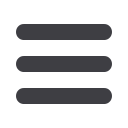
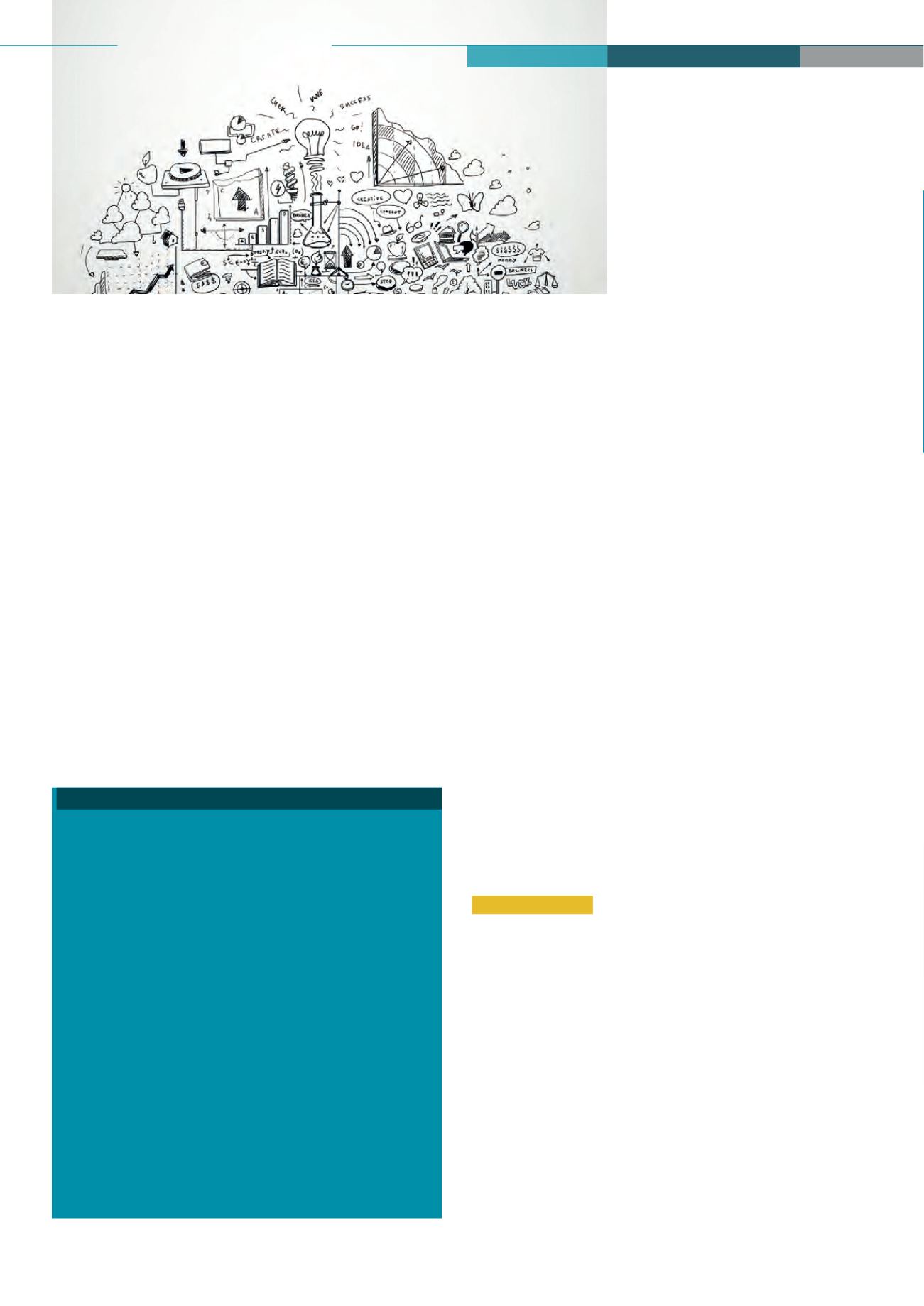
14
physio
austria
inform
September 2015
Den ForscherInnen ist bei der Durchführung einer
»A Priori Analyse« weder die Effektgröße immer genau
bekannt (im Falle, dass eine randomisierte kontrollierte
Studie zu diesem Thema noch nicht herausgegeben
wurde), noch können sie wissen, wie hoch die Standard-
abweichung sein wird. Daher ist es oft schwierig, die
Effektgröße richtig einzuschätzen. Wenn es möglich ist,
empfiehlt es sich eine Pilotstudie durchzuführen, um sie
richtig anzugeben. Sollte dies nicht möglich sein, ist die
nächstbeste Option, sich die notwendige Information
über Behandlungseffekt und Standardabweichung aus
der Literatur zu holen. Aus diesen Werten kann dann die
Effektgröße festgelegt werden. Eine letzte Möglichkeit ist
es, standardisierte Effektgrößenbereiche zu verwenden,
etwa die Werte 0,2, 0,5 und 0,8 für eine kleine, mittlere
und große Effektgröße.
Bei einer bestimmten statistischen Stärke besteht ein in-
direkt proportionales Verhältnis zwischen der Effektgröße
und der ProbandInnenanzahl. Daher ist eine große Effekt-
größe sehr vorteilhaft für die ForscherInnen, da dadurch
die ProbandInnenzahl, die notwendig ist, damit die Studie
eine statistische Aussagekraft hat, reduziert wird. Es gibt
zwei Möglichkeiten, um die Effektgröße zu maximieren:
(a) eine Erhöhung des Behandlungseffekts und (b) eine
Senkung der Fehlervariabilität, indem eine möglichst
homogene Population auserwählt wird.
Willkür und Wahlmöglichkeit
Es ist wichtig zu erwähnen, dass die Festlegung des
Alpha Levels bei 0,05 und der statistischen Stärke von
0,80 eine willkürliche Entscheidung darstellen. Eine
statistische Stärke von 0,80 bedeutet, dass eine 20-
prozentige Chance besteht, dass die ForscherInnen
einen Typ II Fehler machen (z.B. dass eine falsche Nullhy-
pothese nicht verworfen wird). Nun stellt sich die Frage,
warum dieses Risiko nicht reduziert wird, indem eine
statistische Stärke von 0,90 festgelegt wird. Das offen-
sichtlichste Argument ist, dass diese Strategie eine
größere ProbandInnenzahl benötigt. Bei Studien, wo Zeit
und Ressourcen keine Hauptrolle spielen, ist es vorteil-
haft diese Strategie zu verwenden. Nichtsdestotrotz soll-
ten die ForscherInnen diesen Kompromiss sorgfältig
überdenken, denn eine Erhöhung der statistischen Stärke
von 0,80 auf 0,90 benötigt eine exponentielle und keine
lineare Steigerung der ProbandInnenzahl. Es wird daher
empfohlen sowohl für den Wert 0,80 als auch für den
Wert 0,90 die benötigte ProbandInnenzahl zu berechnen,
damit die ForscherInnen das Verhältnis zwischen Proban-
dInnenzahl und statistischer Stärke abwägen können.
Einige MethodikerInnen schreiben, dass wenig aussage-
kräftige Studien dennoch akzeptabel sind, denn diese
könnten in einem Systematic Review oder einer Meta-
Analyse miteinander in Zusammenhang gebracht werden
und wenig Information sei noch immer besser als keine
Information. Auf der anderen Seite befürchten viele
ForscherInnen, dass die wenig aussagekräftigen Studien
mit unklaren Ergebnissen nicht publiziert werden und
bestehen darauf, dass alle Studien statistisch aussage-
kräftig sind. Diese Diskussion wird beim nächsten
WCPT-Kongress 2017 fortgeführt.
Emalie Hurkmans, PhD
x
Themenschwerpunkt
Physiotherapie International
© Sergey Nivens - Fotolia.com
LITERATUR
Beck, T. W. (2013).
The importance of a priori
sample size estimation in
strength and conditioning
research. J Strength Cond Res.
2013 Aug; 27(8):2323-37.
Rubinstein, S. M. et al. (2014).
The risk of bias and sample
size of trials of spinal manipula-
tive therapy for low back and
neck pain: analysis and recom-
mendations. J Manipulative
Physiol Ther. 2014
Oct;37(8):523-41.doi:
10.1016/j.jmpt.2014.07.007.
Epub 2014 Sep 5.
Guyatt, G. H. & Mills,
E. J. & Elbourne, D. (2008).
In the era of systematic
reviews, does the size of an
individual trial still matter.
PLoS Med 2008; 5:e4.
Schulz, K. F. & Grimes,
D. A. (2005). Sample size
calculations in randomised
trials: mandatory and mystical.
Lancet 2005; 365:1348-53.
Halpern, S. D. & Karlawish,
J. H. & Berlin, J. A. (2002).
The continuing unethical con-
duct of underpowered clinical
trials.JAMA 2002; 288:358-62.
SCIENCE
Emalie Hurkmans, PhD
Literatur zum Thema
»Wissenschaftliches Arbeiten«
in der Bibliothek von Physio Austria
Bortz, J. & Döring, N. (2006)
Forschungsmethoden und Evaluation
für Human- und Sozialwissenschaftler.
Heidelberg: Springer Medizin Verlag.
Bühner, M. (2006)
Einführung in die Test- und Fragebogenkonstruktion.
München: ein Imprint von Pearson Education.
Helewa, A. & Walker, J. M. (2000)
Critical Evaluation of Research in Physical
Rehabilitation. Towards Evidence-Based Practice.
Philadelphia; W.B. Saunders Company.
Mayer, H. & Hilten, E. (2007)
Einführung in die Physiotherapieforschung.
Wien: Facultas.
Bestellmöglichkeit via
bibliothek@physioaustria.atbezahlte Anzeige